Der hier zuerst vorgestellte Titel gehört in den größeren Zusammenhang von Opfer, Märtyrertum, Gewalt und Djihadismus. Darum sind im Anschluss an diese Rezension weitere wichtige Veröffentlichungen ausführlich präsentiert.
Kurzrezension: hier
Open Access -
full text download >>>
Sasha
Dehghani /
Silvia Horsch (eds.):
Martyrdom in the
Modern Middle East.
Ex Oriente Lux, Band 14.
Würzburg: Ergon
2014, 225 S., Abb.
Silvia Horsch (eds.):
Martyrdom in the
Modern Middle East.
Ex Oriente Lux, Band 14.
Würzburg: Ergon
2014, 225 S., Abb.
--- ISBN
978-3-95650-030-5 ---
Open Access -
full text download >>>
Ausführliche Beschreibung
Dieser
Band präsentiert die überarbeiteten Beiträge eines Workshops an der Freien
Universität Berlin aus dem Jahr 2011: “Traditions of Martyrdom in the Modern
Middle East”. Entstanden ist dadurch eine Vergleichsperspektive im Blick auf
das Märtyrerverständnis in den monotheistischen Religionen, aber auch unter
Berücksichtigung hinduistischer Traditionen am Beispiel von Mahatma Gandhi. Ein
gewisser Schwerpunkt liegt dabei auf dem Baha’i-Glauben.
Insgesamt werden von
den einzelnen AutorInnen soziologische, philosophische und theologische Aspekte
des Märtyrertums in Vergangenheit und Gegenwart wirkungsgeschichtlich
untersucht. Die Konfliktsituationen in ihrer Unterschiedlichkeit bringen auch Märtyrerprofile
in erstaunlicher Vielgestaltigkeit hervor. Dies schlägt sich in bestimmten
Ritualen, aber auch in den künstlerischen Darstellungen nieder.
Was hier
für den Mittleren Osten genauer bedacht wird, hat erhebliche Auswirkungen auf
Praktiken eines Martyriums insgesamt, das sich zwischen einem ungewollten
Hineingeraten in eine Märtyrersituation und dem bewussten Suchen der
Märtyrerrolle bewegt.
Die
beiden Herausgeber, Sasha Dehghani
(FU Berlin, jetzt im Bahai-Zentrum Haifa) und Silvia Horsch (Universität Osnabrück) verweisen bereits in der Einleitung auf die erheblichen Variationen
und Veränderungen im Bild des Märtyrers, das in gewisser Weise alle
monotheistischen Religionen prägt: Die Entwicklungen, Transformationen,
historischen Manifestationen und kulturellen Besonderheiten erlauben nicht, von
„wahren“ oder „falschen Märtyrern“ zu reden. Es gilt, die jeweilige
geschichtliche Situation zu berücksichtigen, die Martyrien möglich machen und
dann zu bedenken, wie in der Erinnerung an sie Verehrung entsteht (vgl. S. 8).
In vier
Themenkreisen behandeln die AutorInnen darum verschiedene Aspekte des
Martyriums:
1. Kontinuität und Transformation: Martyrium im
Baha’i-Glauben
Die
Baha’i-Religion ist sehr stark durch Martyriums-Erfahrungen geprägt, weil sie
von Anfang an unter dem Druck des Staates und der Mehrheitsreligion stand –
übrigens ähnlich wie das frühe Christentum. Darauf verweist Sasha Dehghani und betont zugleich die
völlig gewaltfreie Ausrichtung dieser monotheistischen Religion – gerade wenn
man die religiös begründeten Baha’i-Verfolgungen im Iran und anderen islamisch
geprägten Ländern ansieht. Auch Per-Olof
Akerdal (Gävle, Schweden) nimmt das Martyriumsverständnis im Baha’i-Glauben
auf und spiegelt es in den anderen monotheistischen Religionen
unter besonderer Berücksichtigung der Kreuzigung Jesu und der schiitischen
Bedeutung von Husseins Martyrium in Kerbela. Er führt das beispielhaft an der
Baha’i-Gemeinschaft von Ishqabad in Turkmenistan des 20. Jahrhunderts vor.
Schließlich stellt der aus dem Iran stammende Religionsforscher Moojan Momen die unterschiedliche Typik
der Martyrien in der Schia und im Baha’i-Glauben vor, geografisch zugespitzt an
Kerbela und Täbriz: die politische Aktivierung von Kerbela durch die islamische
Revolution des Iran 1979 und die passive unpolitische Leidensfähigkeit des Bab,
Vorgänger von Bahá’u’lláh, in Täbriz. (1850).
2.
Bezeugung und Opfer:
Theologische und philosophische Implikationen des Martyriums
Theologische und philosophische Implikationen des Martyriums
In
diesem Kapitel wird der Blick über den Baha’i-Glauben hinaus geweitet. Die Kulturwissenschaftlerin
und Arabistin Angelika Neuwirth (FU
Berlin) sieht sich sunnitische und schiitische „Passionsgeschichten“ in der
Spannung von Legende und historischer Realität genauer an, um auf den
Wesensunterschied von Koran und neutestamentlichen Passionsgeschichten zu
verweisen: Der Kreuzestod Christi ist in islamischer Sicht nicht akzeptabel,
dennoch hat das christliche Märtyrerverständnis in der Schia Spuren
hinterlassen, während in sunnitischen Gesellschaften die mystisch-leidende
opferbereite Liebe zum Ideal wurde. Das allerdings hat sich im 20. Jahrhundert,
besonders in Palästina durch den Verlust des eigenen Landes, verändert, und
zwar konzentriert auf das politische Märtyrertum. Als christliches Beispiel
bringt der Fundamentaltheologe und Religionsphilosoph Joachim Negel (Münster / Marburg) das Glaubenszeugnis und den Tod
der Trappistenmönche von Tibhirine (Algerien) ein. Sie lebten ihre Sinn- und
Leben-stiftende Wahrheit so intensiv, dass sie von vornherein bereit waren, gegebenenfalls
dafür zu sterben. Einen noch anderen Gesichtspunkt bringt Faisal Devji (Oxford), indem er die Souveränität in Gandhis
gewaltlosen Aktionen bis hin zum Risiko des Todes beschreibt. Gandhi setzte der
Militanz der Macht die den Tod bewusst in Kauf nehmende Ohn-Macht entgegen.
Dies wurde zum Zeichen, sich gewaltlos für das Recht auf Leben zu engagieren.
3.
Visuelle Repräsentationen des Martyriums
in Ritualen, Künsten und Neuen Medien
in Ritualen, Künsten und Neuen Medien
Es ist
erstaunlich, wie (parteilich) Mord und Martyrium künstlerisch aufgegriffen
werden, etwa durch eine Theate- Performance zum Stichwort „Massaker“ von Maryam Palizban, eine aus dem Iran
stammende Schauspielerin und Theaterwissenschaftlerin (Berlin) oder die
mystische Idealisierung des vollkommenen Menschen (Märtyrers) bei Malern der
iranischen Revolution, beschrieben von Alice
Bombardier, einer französischen
Soziologin (Paris), oder die von Silvia
Horsch präsentierten Visualisierungen des Erlösungsgedanken in den vom
gewalttätigen Djihadismus und Salafismus geprägten Medien.
4.
Politische Aktion und ideologischer Diskurs
Die
Recherchen zum ideologischen Diskurs im Blick auf bestimmte politische Aktionen
oder deren Rechtfertigung wirkt besonders spannend. Farahad Khosrokhavar, ein französisch-iranischer Soziologe (Paris),
zeigt, wie sich seit dem Kampf gegen Kolonialismus und Imperialismus der djihad veränderte und wie sich damit
(eher lose) das Märtyrertum verband, und zwar zur Erhaltung des Glaubens und für
Gerechtigkeit und Menschenwürde. Der Arabische Frühling hat übrigens an der
Entwicklung in Tunesien gezeigt, wie die Gewaltlosigkeit auch gegen den Feind
dominieren kann. Daneben aber lässt sich an Syrien, Libyen und Jemen beunruhigend
ablesen, dass der Schritt zur gewaltsamen Beseitigung autoritärer Herrscher sehr
schnell gegangen wird und der Tod im gewaltsamen Aufbegehren Qualitäten des
Martyriums (wieder) gewinnt. Lisa Franke
(Leipzig) dagegen ermöglicht durch Ihre Eingrenzung auf den Palästina-Konflikt
das dort entstandene Phänomen des istishhadiyyat,
genauer zu beschreiben, nämlich wie in
einer Widerstandssituation Menschen sich bewusst zum Märtyrer machen.
Silvia Horsch versucht im
Schlussbeitrag ein vorläufiges Resümee unter globaler Sicht zu ziehen: Faktische
Situationen der möglichen und durchgeführten Selbstopferung für ein ethisch
oder politisch erklärtes Ziel werden in Ost und West teilweise recht
unterschiedlich gesehen. Im Gedächtnis bleiben die Protesthandlungen durch Selbstverbrennungen
besonders in Asien und die Selbstmord-Attentate im Nahen Osten, aber auch in
westlichen Ländern. Die Autorin ruft einige dramatische Ereignisse der
Selbstopferung und der „suicid bombers“ seit dem Vietnamkrieg auch mit einigen
Bildbeispielen ins Gedächtnis. Sie betont, dass bei der Beurteilung dieser
Ereignisse säkulare und religiöse Motivationen ineinander fließen. Das erlaubt
kein einfaches Erklärungsmuster im Sinne von „heilig“ oder „profan“.
Bilanz
Das Buch bietet wichtige Einsichten in
die religiös-theologischen Grundmuster von(Selbst-)Opfer und Martyrium,
hauptsächlich in den monotheistischen Religionen und in gesellschaftlichen
Zusammenhängen. Es ist ein weiterführender Beitrag zur Aufarbeitung eines
politisch-kulturell-religiösen Spannungsfeldes, das angesichts von
Unterdrückung und Konflikt aktuell mit zum Teil heftiger Deutlichkeit auftritt.
Die ungewollten und gewollten Martyrien sind eine Herausforderung an
Menschenwürde und Menschenrechte. Die Wiederherstellung der Humanität gehört zu
den dringendsten globalen Aufgaben!
Das Martyrium als sozialer Prozess
--- IRIS - Institut de Relations Internationales et Stratégiques (France),
No. 569 --- Novembre 2015 ---
Vgl. zum Themenfeld von
Martyrium, Opfer und Djihadismus in Geschichte und Gegenwart
Martyrium, Opfer und Djihadismus in Geschichte und Gegenwart
die folgenden (rezensierten) Titel:
- Märtyrinnen und Märtyrer.
Themenheft "Religion unterreichten" 2020, 1. Jg., Heft 2, 92 S.
- Fethi Benslama und der radikalisierte Islam. Kommentierte Bücherschau: hier
- Arnold Angenendt: Die Revolution des geistigen Opfers.
Blut – Sündenbock – Eucharistie. Freiburg: Herder 2011.
Rezension in der Auseinandersetzung mit Réne Girard: hier
Norbert Otto Eke/Angelika Strotmann (Hg.):
Davidfigur und Opfermotiv Jüdisch-christliche Transformationen.
Paderborn: Schöningh (Brill) 2019, VI, 321 S., Abb., Tabellen- René Girard: Das Ende
der Gewalt. Analyse des Menschheitsverhängnisses.
Freiburg u.a.: Herder 2009 --- Rezension: hier - René Girard: Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz.
Eine kritische Apologie des Christentums. Taschenbuch 9.
Frankfurt/M. und Leipzig. Verlag der Weltreligionen 2008, 254 S.
Rezension: hier
- Philosophische Nachforschungen
zum modernen Djihadismus
unter besonderer Berücksichtigung von René Girard
Philosophical Journal of Conflict and Violence (PJCV),
Vol. I (Issue 2/2017, December) - Thorsten Hoffmann: Sterben für den Glauben.
Ursprung, Genese und Aktualität des Martyriums
in Christentum und Islam.
Beiträge zur Komparativen Theologie Bd. 30.
Paderborn: Schöningh 2018, XVI, 448 S.
- Alireza Korangy / Leyla Rouhi (eds.):
The 'Other' Martyrs.
Women and the Poetics of Sexuality, Sacrifice, and Death
in the World Literatures
Wiesbaden: Harrassowitz 2019, X, 132 pp., illustr.
Verlagsinformation --- Inhaltsverzeichnis mit Einleitung >>>
- Christoph Auffarth:
Opfer. Eine Europäische Religionsgeschichte
Theologische Bibliothek 8
Göttingen: V & R (Brill) 2022, 251 S., Abb.
ISBN 978-3-525-55465-4.
Inhaltsverzeichnis & Leseprobe >>> - Meinrad Limbeck: Abschied vom Opfertod.
Das Christentum neu entdecken.
Mainz: Grünewald 2018, 6. Aufl., 160 S. - Józef Niewiadomski /
Roman A. Siebenrock u.a. (Hg.):
Opfer – Helden – Märtyrer.
Das Martyrium als religionspolitische Herausforderung.
Innsbrucker theologische Studien, Bd. 83. Innsbruck: Tyrolia 2011
Rezension: hier Jürgen Werbick (Hg.): Sühne, Martyrium und Erlösung?
Opfergedanke und Glaubensgewissheit
in Judentum, Christentum und Islam.Beiträge zur Komparativen Theologie, Bd. 9. Paderborn: Schöning 2012
Rezension in Biblische Bücherschau:
http://www.biblische-buecherschau.de/2014/Werbick_Suehne.pdf
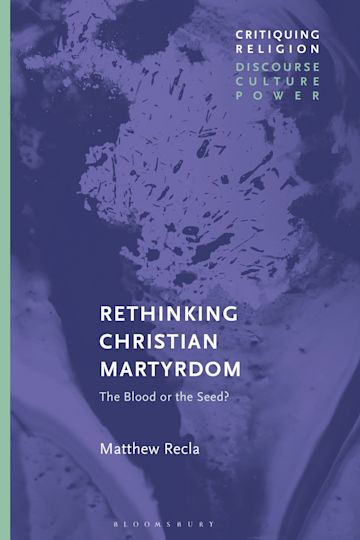 |
Matthew Recla
|



Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen